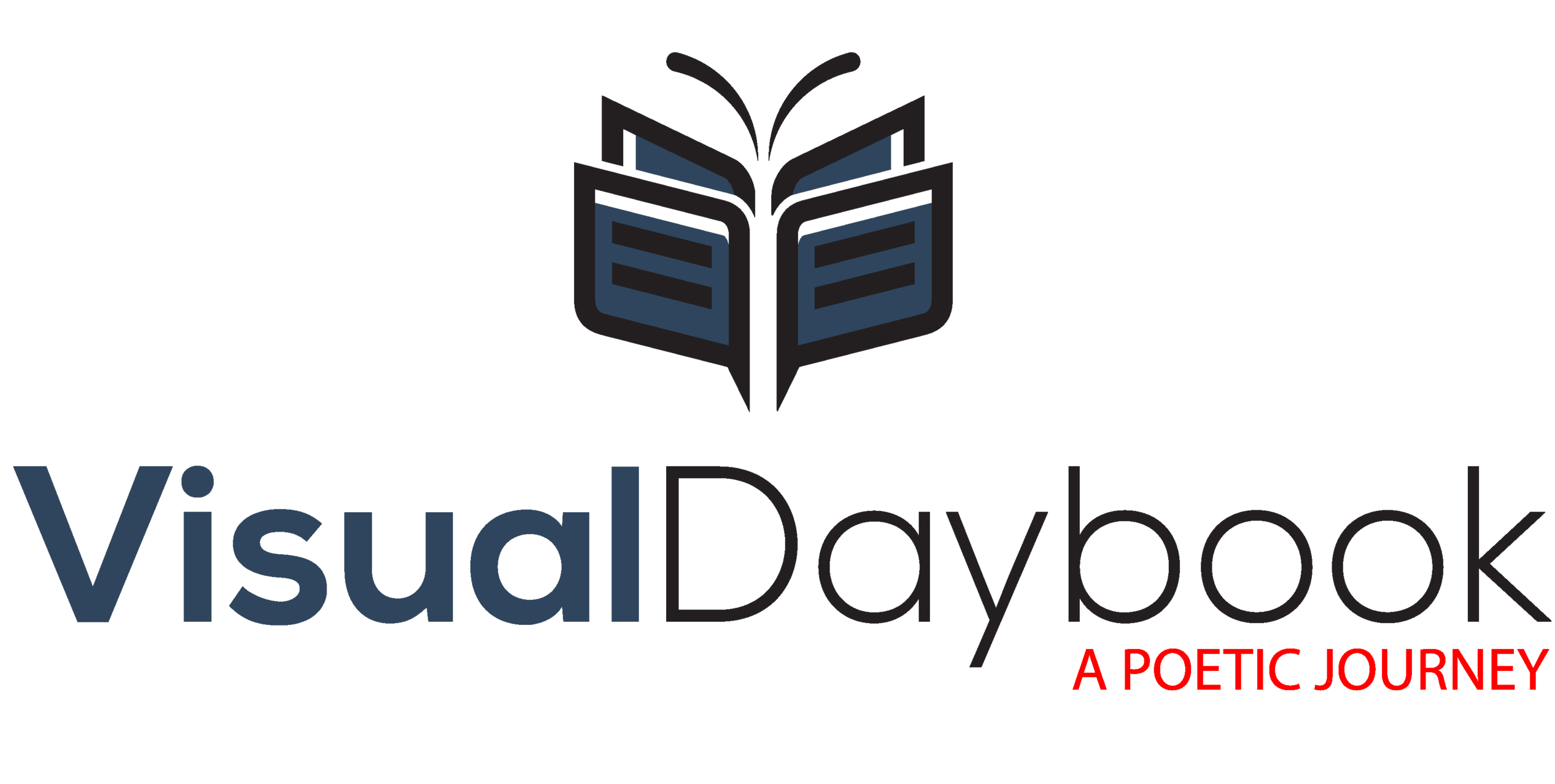Ruhezeiten
Ich saß auf einer Umzugskiste und schaute mich um. Durch das Fenster zur Straße fiel Sonnenlicht auf den Boden der kleinen, unordentlichen Wohnung und es war ganz still. Ich fragte mich, wie lange ich hier bleiben würde, wo ich das Bett aufstellen sollte, ob es Sinn machte, die Bücherkisten auszuräumen. Ich brauchte Regale, ein paar Teller und Besteck, zwei oder drei Töpfe. Und natürlich eine Ecke mit Spielzeug.
Angefangen hatte alles an einem Wochenende vor einem Jahr. Vera und ich wohnten mit unserem Sohn Rouven in einer geräumigen Altbauwohnung, die wir uns nur durch ihr Oberarztgehalt leisten konnten. Unser Sohn war zwei Jahre und spielte mit mir in der offenen Küche. Dabei bewegte er seinen Nuckel spielerisch vom rechten zum linken Mundwinkel und zurück. Dann schaute er schelmisch zu mir auf und zerbiss das vertraute Beruhigungsmittel. Das hatte er schon öfters getan, obwohl er wusste, dass er das nicht machen sollte. Ich warf ihm einen strengen Blick zu, ließ es dann aber dabei bewenden. Einen Ersatznuckel fand ich in der Wohnung nicht. Nur noch den Einkaufszettel, auf dem er sich eine Position weit oben gesichert hatte. Für einen Moment hatte ich die Illusion, es wäre ein guter Zeitpunkt für Rouven, sich vom Nuckel zu entwöhnen. Das war damals die Hoffnung.
Im Supermarkt waren sie ausverkauft, online waren sie nicht lieferbar und Gespräche mit anderen Eltern bestätigten, es war nahezu unmöglich, neue Schnuller zu bekommen. Für Säuglinge musste die Brust herhalten und das länger als gewöhnlich. Rouven ging schon bald in den Kindergarten, brauchte aber den Gumminippel täglich zur Beruhigung. Wir probierten einen Schnuller aus Kautschuk, aber er mochte ihn nicht. Wir versuchten Greiflinge aus Holz, bissfestes Spielzeug, Kühlkissen und schließlich alte aussortierte Stofftücher, aber nichts führte zu einem nachhaltigen Erfolg. Im Gegenteil, die Schreie der Unzufriedenheit wurden schriller, lauter und nervenaufreibender.
Alternative Energien hatten begonnen, unser Leben sauberer und nachhaltiger zu machen. Durch die geringeren Fördermengen von Öl wurden weniger Kunststoffe hergestellt. Die synthetische Produktion war energieintensiv und die führenden Unternehmen konzentrierten sich auf Produkte mit hohen Gewinnmargen. Silikon wurde weltweit als Dichtungsmittel benötigt und die plastische Chirurgie erfreute sich einer ungebremsten Nachfrage. Die Menschen wurden älter und bekamen weniger Kinder. Kurzum, die Wirtschaft hatte wichtigere Wachstumsfelder identifiziert als frühkindliche Bedürfnisse. Ein unerwarteter Fall von Generationenungerechtigkeit.
Alle Eltern schienen das gleiche Problem zu haben. Wenn ich mit Rouven auf den Spielplatz ging, waren die Kinder zunächst abgelenkt und spielten, aber wenig später ging das Gekeife los. Vereinzelt, dann in kleinen Gruppen, wie eine Sinfonie, die gegen den Status quo anspielte, nicht akzeptieren konnte, dass es keinen Trost in vertrauter Form und Konsistenz gab. Sie zu beruhigen, war eine stetige Aufgabe, die nicht erfüllt werden konnte. Es brachte uns näher zu unseren Kindern, aber es entfremdete uns auch. Wir waren hilflos geworden, unser Trost reichte nicht aus, die Kinder spürten einen Verlust, der nicht zu kompensieren war.
An einem verregneten Sonntag ging ich nach etlichen schlaflosen Nächten verzweifelt mit Rouven auf einen Spielplatz. Ich brauchte Bewegung und frische Luft, wollte der Schallverstärkung unser Wohnung entkommen. Während Rouven spielte, beobachtete ich eine junge Frau, die auf einer Bank saß und in einem dicken Buch von Dostojewski las. Vor ihr befand sich ein Kinderwagen und aufgrund der ungewohnten Stille, hatte der Moment eine gewisse Magie. Ich vermutete zunächst, dass das Kind schlief, hörte dann aber ein schmatzendes Geräusch. Als ich mich dem Kinderwagen näherte, sah ich, dass eine Tüte mit rötlichen Stücken seitlich daran baumelte. Die Frau schien mich nicht zu bemerken und als ich in den Kinderwagen blickte, traute ich meinen Augen nicht. Zwei von dieser Welt entkoppelte Augen schauten mich ernst an und führten meinen Blick zu einem Stück rohem Fleisch, an dem das Kind gierig saugte.
Als ich Vera davon erzählte, sah sie mich entsetzt an. Wir waren Vegetarier und es bedurfte keiner Diskussion, dass dieser – wenn auch Erfolg versprechende – Weg für uns nicht möglich war. Aber was war überhaupt noch möglich? Um uns herum schrie die Welt unaufhörlich aus jungen, rosig durchbluteten Kehlen. Die Hilferufe trafen uns ins Mark, ließen uns nicht mehr schlafen. Jeder kleinste Moment der Ruhe war verdächtig, die Uhrzeit spielte keine Rolle mehr. Meine Augenlider fingen nervös an zu zucken, ich wurde vergesslich, ungehalten und gleichgültig.
Unsere Freunde kamen nicht mehr zu Besuch. Die, die selbst Kinder hatten, scheiterten am Versuch, wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen. Die Großeltern mieden uns, ihr Nervenkostüm hielt den Belastungen nicht stand. Der Ton zwischen Vera und mir wurde schärfer, rücksichtsloser, man schrie, um sich überhaupt noch zu verstehen. Wir gingen dem jeweils anderen aus dem Weg und wollten einfach nur unsere Ruhe haben. Von den bedürftigen, kindlichen Schreien und auch vor dem Klagelaut der Ausweglosigkeit, der sich in uns breit gemacht hatte.
Eines Abends lag ich im Bett und hörte die Jalousie langsam und rhythmisch gegen den geöffneten Fensterrahmen schlagen. Meine Augen waren feucht und ich wimmerte, gleichmäßig wie der Wind, der durch das Zimmer wehte. Ich hätte nie gedacht, dass der Mangel an einem Produkt unser Miteinander so ins Wanken bringen könnte. Vera arbeitete im Krankenhaus und war kaum noch zuhause. Ich organisierte den Haushalt und kämpfte um einen Platz im Kindergarten mit längerer Betreuungszeit. Unsere Situation schien aussichtslos.
Ich machte mich zum Hampelmann. Wenn Rouven seinen Nuckel wollte, lenkte ich ihn mit irgendwelchem Schabernack ab. Das zog ihn immer wieder vorübergehend in den Bann und dann drückte ich ihn an mich, um ihm vertraute Nähe zu geben. In der Öffentlichkeit beobachtete ich viele Eltern, die in ähnlicher Weise fortwährend mit ihren Kindern herum blödelten. Das war eine Möglichkeit, zumindest so lange, bis einem etwas besseres einfiel. Die grauen Bürgersteige wurden zum fröhlichen Kasperletheater.
Nach Monaten der Verzweiflung und Erschöpfung traf ich eine Entscheidung. Ich holte Rouven nach dem Mittagsschlaf aus der Kita ab und schob ihn im Kinderwagen in die Stadt. Er hatte unruhig geschlafen und fing schon auf dem Weg an zu jaulen. Ich suchte den renommiertesten Schlachter der Stadt auf und stand vor der gläsernen Theke, wie vor einem Schiedsgericht. Das, was ich aus Überzeugung jahrelang abgelehnt hatte, war vielleicht das letzte Mittel. Ich kaufte 150 Gramm Rindfleisch in Stücken, als wollte ich Gulasch zubereiten und verließ den Laden, als hätte ich eine Straftat begangen.
Einige Meter vom Tatort entfernt, öffnete ich die Tüte und schaute zweifelnd hinein. Rouven hatte schon ein rotes Gesicht und war mit bebenden Lippen am Brüllen. Ich griff beherzt in das Plastiksäckchen und gab ihm ein relativ großes, leuchtend rotes Stück. Dann kniff ich die Augen zusammen und wartete, als könnte ich mich zwischen meinen Wünschen nicht entscheiden. Ich hörte Schritte neben mir, nahm Gesprächsfetzen war, eine Klingel, ein Rascheln, aber Schreie vernahm ich nicht. Langsam öffnete ich die Augen, erst blinzelnd, dann forsch mit der Sehnsucht nach Gewissheit, und spürte, wie mir eine kleine Träne die rechte Wange hinunterrann. Rouven saugte kräftig, fast apathisch an dem toten Stück Tier.
Vera war für das Wochenende zu ihrer Mutter gefahren, das verschaffte mir ein wenig Zeit. Ich nahm unsere Reisekühlbox im Keller in Betrieb und versteckte dort die animalische Lösung. Rouven erhielt je nach Bedarf ab und zu ein Stück aus der Kühlbox und hatte eine ansteckende Gelassenheit. Als Vera am Sonntag Abend nach Hause kam, erzählte ich ihr, dass Rouven weniger schrie. Ich argumentierte, er akzeptiere wohl, dass es in dieser Welt keine Nuckel mehr gäbe oder seine Bedürfnisse sich einfach geändert hatten. Vera nahm das zur Kenntnis, war aber zu müde, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie sagte, dass es in der Wohnung muffig rieche und wir darüber morgen sprechen sollten.
In der folgende Woche hatte Rouven Geburtstag. Wir planten eine kleine Party mit zwei befreundeten Jungen und deren Eltern. Ich hatte ein ferngesteuertes Auto mit blinkenden Scheinwerfern besorgt, das keine Geräusche machte. Eine Spur von Normalität hielt Einzug und ich hatte das Gefühl, wir hätten das Schlimmste überwunden. Am Vorabend machte Vera eine Torte, aber unser Kühlschrank war schon voll. Ich dachte nicht weiter darüber nach, sah aber plötzlich, dass die Wohnungstür offenstand und Vera in den Keller gegangen war. Die Torte hatte sie mitgenommen.
Was jetzt passierte, war nicht mehr kontrollierbar. Ich setze mich auf die flauschige Recamiere unseres Sofas und wartete. Als ich ihre Schritte wieder im Treppenhaus hörte, wusste ich, dass sie in Rage war. Sie knallte die Tür ins Schloss und kam mit unbändiger Wut auf mich zu. Dann schrie sie mich an, was mir einfallen würde. In der Hand hielt sie eine Tüte vom Schlachter und fuchtelte damit herum. Ich versuchte mehrmals etwas zu sagen, aber sie ließ mich nicht zu Wort kommen. Ich hatte sie enttäuscht, ihr Vertrauen verloren, unsere Ideologie verraten. Sie hämmerte auf meine Brust. Ich versuchte, sie zu umarmen, aber ich schaffte es nicht.
In den folgenden Tagen verstand ich langsam, was zwischen uns passiert war. Rouven fing wieder an zu schreien und jetzt wurde das Gekreische unerträglich. Vera und ich fanden nicht mehr ins Gespräch. Nach einigen Wochen bat sie mich, meine Sachen zu packen. Wir sollten zumindest vorübergehend getrennte Wege gehen. Sie hörte mir nicht mehr zu und ich hatte auch wenig zu sagen. Die Dinge hatten sich gefügt, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte.
Ich hatte mir eine Ein-Zimmer-Wohung gesucht und meinen Auszug organisiert. Nur das Notdürftigste wollte ich mitnehmen, dachte ich doch, wir würden diese Zeit überstehen. Ein Stück Fleisch sollte eine Familie nicht trennen können.